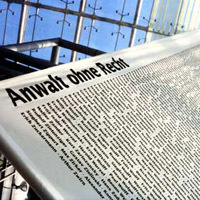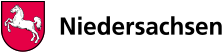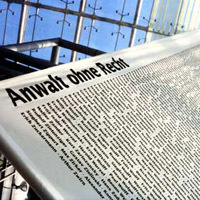
Ausstellungseröffnung der Rechtsanwaltskammer Braunschweig „Anwalt ohne Recht“ am 11.01.2006
Grußwort des Präsidenten des Oberlandesgerichts Edgar Isermann
Lieber Herr Präsident Schlüter,
sehr geehrte Damen und Herren,
für das Oberlandesgericht und zugleich für Herrn Generalstaatsanwaltschaft Wolf danke ich mit den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Bezirks für die Einladung zu dieser Veranstaltung.
Zugleich gratulieren wir Ihnen, dass diese Ausstellung zu diesem wichtigen Thema jetzt auch in Braunschweig zu sehen ist.
Sie ergänzt die Wanderausstellung, die vom Nds. Justizministerium im Jahre 2001 initiiert wurde und seitdem in vielen Orten in Niedersachsen, aber auch darüber hinaus, zu sehen war: "Justiz im Nationalsozialismus – Über Verbrechen im Namen des Volkes".
Wir wünschen Ihnen und uns, dass Ihre Veranstaltung auf ein ebenso großes Interesse der Öffentlichkeit stößt wie die Justiz-Ausstellung.
Das sind wir denjenigen schuldig, die als "Anwalt ohne Recht" persönliches Leid und Unrecht erfahren mussten.
Wenn wir uns heute – mehr als 60 Jahre nach Kriegsende – diesem Thema stellen, drängt sich die Frage auf: Warum erst jetzt ?
Mit dem Abstand der Zeit und mit der Erfahrung lässt sich aus meiner Sicht sagen, dass wir 3 Phasen unterscheiden können. Sie lassen sich unterteilen in die Stufen "Vergessen – Verdrängen – Erforschen".
In den ersten Jahrzehnten der Nachkriegszeit war in Deutschland das Bedürfnis, sich mit den Ursachen und grausamen Realitäten der jüngsten Vergangenheit auseinander zu setzen, nur gering ausgeprägt.
Das Vergessen-Wollen stand im Vordergrund.
Die Justiz, der es oblägen hätte, im Namen des Rechts sich der Vergangenheit zustellen, hat versagt, als es damals darum ging, das NS-Unrecht mit den Mitteln des Rechts zu ahnden.
Eine besondere Hypothek liegt dabei auf der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in den 50er und 60er Jahren. Dem jetzigen BGH-Präsidenten Prof. Hirsch ist zu danken, dass er öffentlich eingeräumt hat, man müsse sich "dafür schämen" – ein Statement aus dem Jahr 2002 (zum "Huppenkothenverfahren" 1956).
Erst einige Jahrzehnte nach Kriegsende änderte sich das. Die nachwachsende Generation stellte immer mehr Fragen nach dem Warum und der Schuld und Mitverantwortung der Elterngeneration. Diese Diskussionen brachten viel Unruhe in die Gesellschaft und in viele Familien – aber auch in die Justiz.
Vielen Älteren waren die Fragen unangenehm, weil sie eigene biografische Erlebnisse mit dem Ausmaß an Schuld in Einklang bringen mussten, das auf der Nation insgesamt lastete.
Noch gut erinnern kann ich mich an die Aufregung um die Vortragsreihe "Braunschweig unterm Hakenkreuz" (1981), die von dem OLG-Richter Kramer ins Leben gerufen war und auch innerhalb der Justiz viel Aufregung hinterließ.
Der Saal im Städtischen Museum war jedes Mal zum Bersten voll und das öffentliche Interesse war enorm. Es gab viele, auch in der Justiz, die es lieber gesehen hätten, wenn dieses Thema nicht aktualisiert worden wäre. So manche Bemühung damals, die bei der Betrachtung der Vergangenheit auf Verständnis und Verharmlosung abzielte, ist im Licht der Geschichte noch bizarrer als sie schon damals tatsächlich war.
Ich glaube, es ist ein Privileg meiner Generation, dies so deutlich sagen zu dürfen.
Die Zeit des Aufarbeitens des Kapitels der NS-Geschichte und damit die Zeit des "Erforschens", gerade auch für die Justiz, begann Ende der 80er / Anfang der 90er Jahre. Hier spielte Braunschweig eine verdienstvolle Rolle. Viele Anstöße kamen von hier, gerade auch aus dem Kreis der Justiz.
Eine große Bedeutung kam dabei auch dem Saal zu, in dem wir uns heute befinden.
Hier fand im Beisein des Bundesministers der Justiz und des Niedersächsischen Landesministers der Justiz am 7. November 1988 eine Veranstaltung statt, in der erstmals in der Nachkriegsgeschichte die deutsche Justiz öffentlich des Schicksals der jüdischen Juristen gedachte.
Mein Vor-Vorgänger im Amt, der damalige OLG-Präsident Wassermann, nahm die 50. Wiederkehr des Judenprogroms vom 10. November 1938 zum Anlass, das Wirken jüdischer Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Notare ehrend zu würdigen.
Es war das erste Mal in der Bundesrepublik Deutschland, dass die Justiz sich der Geschichte in dieser Weise stellte. Entsprechend groß war die bundesweite Resonanz.
Anlässlich dieser Veranstaltung wurde die von Herrn Präsident Schlüter bereits erwähnte Gedenktafel enthüllt, die an der Eingangstür zu diesem Saal angebracht ist. Sie trägt folgenden Text:
"Zur Erinnerung an die Verdienste, die
Diskriminierung und die Verfolgung jüdischer
Juristen."
Die davon ausgehende Mahnung gilt heute fort.
Meine Damen und Herren,
wenn wir heute schon den Blick zurück richten, um eine Orientierung für morgen zu haben, dann möchte ich in Ergänzung der Ausführungen von Herrn Schlüter noch einen weiteren Aspekt erwähnen.
In § 1 der BRAO heißt es: "Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege."
Diese Formulierung ist uns ebenso gängig wie sie auch eine unproblematische Selbstverständlichkeit zum Ausdruck zu bringen scheint.
Wer sich mit der Anwaltsgeschichte befasst, sieht indes, dass in einigen Zeitabschnitten die "Organstellung" des Anwalts vor allem im Bereich der Strafrechtspflege sogar hochproblematisch war.
Im Strafprozess prallen das Interesse des Staates an einer effizienten Strafrechtsverfolgung zusammen mit dem Verteidigungsinteresse des einzelnen Angeklagten. Das Thema ist nicht nur heute aktuell. Sehr viel kontroverser als heute ist vor allem in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts um die Anwaltsstellung gekämpft worden.
Immer dann, wenn es darum ging, hier eine Grenze zwischen Staatsinteresse und Verteidigerinteresse zu ziehen, waren die staatlichen Institutionen eher geneigt, mit Rückgriff auf die Stellung des Anwalts als "Organ der Rechtspflege" das Staatsinteresse in den Vordergrund zu stellen und Verteidigerrechte zu beschränken.
Auch hier sprachen manche sinngemäß vom "Anwalt ohne Recht". Gerade die Literatur der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts belegt das, etwa mit den Schriften des berühmten und hochangesehenen Berliner Strafverteidigers Alsberg.
Die Einordnung des Anwalts als "Organ der Rechtspflege" tauchte erstmals 1893 in einer Entscheidung des Ehrengerichtshofs für Rechtsanwälte auf. Damals war es gerade wenige Jahre her, dass die Anwaltschaft aus dem Status des beamteten Richtergehilfen in die freie Advokatur entlassen war.
Die sich anschließenden Diskussionen um die Neuorientierung im Strafprozess waren heftig.
Ostler schreibt in seiner Geschichte der deutschen Anwälte vom "Kriegsschauplatz: Richterbund contra Anwaltschaft" und beklagte dabei den Hochmut der Richter gegenüber den "freien Anwälten".
Angesichts der von Herrn Schlüter gerade anschaulich dargestellten Auswüchse in der NS-Zeit verwundert es nicht, dass der Begriff "Organ der Rechtspflege" mit der AV des Reichsjustizministers vom 13.4.1935 erstmals amtlichen Charakter bekam.
Von da ab war es leicht, den Verteidiger und seinen Aufgabenbereich als "unbeamteter Hoheitsfunktionär", wie es damals hieß, vollends in die staatliche Pflicht zu nehmen. Der Anwalt hatte der "Volksgemeinschaft" zu dienen, nicht dem Individuum.
Ebenso passt es, dass auch im totalitären Regime der DDR der Anwalt eine nahezu rechtlose Stellung hatte.
Auch aus heutiger Sicht, aber mit ganz anderem Grundverständnis, ist es sicher richtig, der staatlichen Strafverfolgung den Vorrang einzuräumen, etwa dann, wenn wir an die Fälle der sog. Konfliktverteidigung denken, also an die Fälle, bei denen das Verzögerungsinteresse oder auch das Gebühreninteresse eines Verteidigers zu unvertretbaren Auswüchsen führen.
Mir geht es aber nicht darum, das heute zu diskutieren.
Ich möchte nur sensibel machen dafür, dass auch mit sehr juristischen Begriffen wie dem des Anwalts als "Organ der Rechtspflege" die "Rechtsanwälte" zu "Anwälten ohne Recht" umfunktioniert werden konnten und wurden.
Dieser Aspekt sollte uns ebenfalls eine Mahnung bleiben, denn der Rechtsstaat ist immer auch die Summe der Rechte eines jeden Individuums.
Dieses Spannungsverhältnis nimmt die BRAO auf.
In § 3 heißt es deshalb, dass der Rechtsanwalt "der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten ist".
Recht entsteht durch Rechtsprechung.
Im Zusammenwirken von Justiz und Anwaltschaft und im wechselseitigen Respekt der jeweiligen Aufgaben, wie sie uns nicht zuletzt durch die soziologischen Erkenntnisse der Rollentheorie bekannt sind, sind die Voraussetzungen für ein rechtsstaatliches Verfahren gegeben.
Das zu wahren, bleibt unsere ständige Aufgabe für die Justiz wie für die "Anwälte mit Recht".
Meine Damen und Herren,
mit der heutigen Ausstellung erscheint das Buch "Zulassung ist zurückgenommen".
Die beiden Herausgeber, Herr Schlüter und Herr Miosge, haben sich in höchst verdienstvoller Weise der Biografien verfolgter Juristen gewidmet. Zu diesem vorzüglichen Buch möchte ich herzlich gratulieren.
Dass gerade ein praktizierender Rechtsanwalt und ein ehemaliger Richter dieses Thema gemeinsam angegangen sind, ist für mich auch ein Beleg, wie unverkrampft Justiz und Anwaltschaft in unserer Zeit miteinander verkehren. Dafür darf unsere Generation auch dankbar sein.
Die heute eröffnete Wanderausstellung wandert weiter.
Die Buchveröffentlichung als Dokument bleibt erhalten.
Indem Sie, Herr Schlüter und Herr Miosge, uns den beschämenden Umgang der damals Herrschenden mit Juristen jener Zeit vor Augen führen, verdienen Sie den Dank aller, die sich dem menschlichen Anstand und den Geboten des Rechtsstaats verpflichtet fühlen.
Haben Sie vielen Dank.