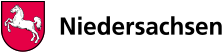Allgemeine Hinweise zum Verfahren auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses nach § 1309 BGB
2. Bearbeitung der Anträge / Auskünfte zum Verfahren
3. Urkundenvorlage und Länderverzeichnis
6. Legalisation/ Apostille und inhaltliche Überprüfung
8. Identitäts- und Staatsangehörigkeitsnachweis
9. Asylberichtigte, ausländischen Flüchtlinge und heimatlose Ausländer
10. Meldebescheinigungen und ausländerrechtlicher Status
Nach Art. 13 Abs. 1 EGBGB unterliegen die Voraussetzungen der Eheschließung für alle Verlobten dem Recht des Staates, dem sie angehören. Gemäß § 1309 Abs. 1 BGB soll der / die ausländische Verlobte vor der Eheschließung ein Zeugnis der inneren Behörde des Heimatstaates darüber beibringen, dass der Eheschließung nach dem Recht dieses Staates kein Ehehindernis entgegensteht.
Angehörige der Staaten, die ein solches Ehefähigkeitszeugnis nicht ausstellen, können gemäß § 1309 Abs. 2 BGB durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts von dem Erfordernis der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses befreit werden. Der Präsident des Oberlandesgerichts prüft dabei aus Sicht der inneren Behörde des Heimatstaates entsprechend Art. 13 Abs. 1 EGBGB, ob der beabsichtigen Eheschließung ein Hindernis entgegensteht.
Der Antrag auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses nach § 1309 Abs. 2 BGB ist durch das für die Eheschließungsanmeldung zuständige Standesamt in einer Niederschrift (Antragsvordruck) aufzunehmen und die Entscheidung über den Antrag vorzubereiten (§ 12 Abs. 3 PStG). Eine Vertretung bei der Antragstellung durch eine/n Bevollmächtigte/n ist möglich. In diesem Fall ist die Vorlage einer Originalvollmacht erforderlich, hierbei ist das zum Download zur Verfügung gestellte Formular „Vollmacht“ zu verwenden.
Das Oberlandesgericht Braunschweig ist gemäß § 1309 Abs. 2 BGB zuständig für die Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses, wenn die Eheschließung bei einem Standesamt innerhalb des Bezirks des Oberlandesgerichts Braunschwieg angemeldet wurde.
Zur Vorbereitung der Anträge durch das Standesamt gelten die folgenden allgemeinen Hinweise zu 2. bis 12.2. Bearbeitung der Anträge / Auskünfte zum Verfahren
Um eine zügige und kontinuierliche Bearbeitung aller Anträge beim Oberlandesgericht in der Reihenfolge des Eingangs zu gewährleisten, ist eine persönliche Vorsprache der Verlobten oder Dritter bei den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern des Oberlandesgerichts nicht erforderlich.
Informationen über das Eheschließungsverfahren des Standesamts und das Befreiungsverfahren beim Oberlandesgericht erteilt in erster Linie das Standesamt. Auskünfte über den Stand des Verfahrens sind ebenfalls beim Standesamt einzuholen.
Die Bearbeitungsdauer der Anträge beträgt in der Regel 3 bis 6 Wochen. Durch Beanstandungsverfügungen (z. B. aufgrund fehlender Urkunden) oder aufgrund ggf. erforderlichen Einsichtnahme in die Ausländerakten kann sich die Verfahrensdauer verzögern. Wir bitten um Ihr Verständnis.
3. Urkundenvorlage und Länderverzeichnis
Das Oberlandesgericht Bamberg hat zu den einzelnen Ländern, für deren Staatsangehörige ein Verfahren gemäß § 1309 Abs. 2 BGB durchzuführen ist, auf seiner Internet-Präsenz ein Länderverzeichnis (Verlinkung zu https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/bamberg/gerichtstafel.php) bereitgestellt. Dieses wird ständig aktualisiert und bildet die Grundlage für die Anforderungen des Oberlandesgerichts Braunschweig zu den urkundlichen Nachweisen.
Die in dem Länderverzeichnis aufgeführten Hinweise dienen als Orientierungshilfe, bieten jedoch keine Garantie auf Vollzähligkeit. Insbesondere ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass weitere Unterlagen und urkundliche Nachweise zur Person des/der Antragsteller/in angefordert werden können.
Zum beweiskräftigen Nachweis des in der Urkunde dokumentierten Personenstandsvorganges sind die Urkunden dem Antrag in jedem Fall im Original beizufügen. Beglaubigte Kopien - sofern nicht ausdrücklich im Länderverzeichnis des Oberlandesgerichts Bamberg (s. 3. Länderverzeichnis) genannt - genügen i. d. R. nicht, da sich bestimmte Urkundeneigenschaften wie Papierqualität, Stempelfarbe etc. nur anhand der Originale feststellen lassen.
Zum Nachweis der personenstandsrechtlichen Verhältnisse (Familienstand) müssen aktuelle urkundliche Nachweise vorgelegt werden, welche nicht älter als 6 Monate sein dürfen. Die Frist von 6 Monaten wird von der Ausstellung der Urkunden bis zur Vorlage beim Standesamt gerechnet. Aufgrund einer im laufenden Eheschließungs- oder Befreiungsverfahren nachträglich geforderten Legalisation der Urkunden oder sonstiger noch zu erfüllender Auflagen ist der Ablauf der 6-Monats-Frist im Einzelfall dann unschädlich, wenn die Brautleute das Eheschließungsverfahren zügig und ohne Unterbrechung betrieben haben.
6. Legalisation/ Apostille und inhaltliche Überprüfung
Die Originale der Urkunden sind grundsätzlich mit der Legalisation der zuständigen deutschen Auslandsvertretung oder mit der Apostille der zuständigen ausländischen Heimatbehörde zu versehen. Mehrsprachige Urkunden, die von einem der Vertragsstaaten nach dem Muster der Übereinkommen der Internationalen Kommission für das Zivil- und Personenstandswesen (CIEC) ausgestellt werden, sind in Deutschland von jeder Förmlichkeit befreit.
Die inhaltliche Überprüfung von ausländischen Urkunden ist in Staaten erforderlich, in denen die Voraussetzungen zur Legalisation nicht gegeben sind. Sie erfolgt im Rahmen der Amtshilfe durch die zuständige deutsche Auslandsvertretung. In der vom Auswärtigen Amt herausgegebenen Liste der Länder mit unzuverlässigem Personenstandswesen sind die Staaten bezeichnet, in welchen das Legalisationsverfahren durch die inhaltliche Prüfung der Urkunden ersetzt wird.
Hinweise zum Erhalt der Apostille, zur Legalisation durch die deutschen Auslandsvertretungen und zu den jeweiligen Vertragsstaaten können auf den Internetseiten des Auswärtigen Amtes (Verlinkung zu https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo) abgerufen werden.
Übersetzungen sind nach § 142 Absatz 3 der Zivilprozessordnung (ZPO) in Verbindung mit den §§ 107 ff. FamFG ausschließlich von einem / einer in der Bundesrepublik Deutschland amtlich zugelassenen und beeidigten Urkundenübersetzer/in zu fertigen. Der fremdsprachige Text ist von der Ursprungssprache direkt in die deutsche Sprache ohne „Zwischenübersetzung“ in eine andere Sprache zu übersetzen.
Ausnahmen gelten für sog. internationale mehrsprachige Urkunden und Übersetzungen von Urkunden, die aus der EU stammen. Bei Fragen wenden Sie sich ggf. an Ihr Standesamt.
8. Identitäts- und Staatsangehörigkeitsnachweis
Ausländische Staatsangehörige haben in Verfahren zur Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Staatsangehörigkeit eine amtlich beglaubigte Ablichtung ihres gültigen Reisepasses (Auslandspass) vorzulegen. Bürger/innen aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die nicht über einen Reisepass verfügen, können ihre Identität mit einer beglaubigten Kopie des ausländischen Personalausweises belegen.
Bei deutschen Staatsangehörigen ist die Vorlage einer beglaubigten Kopie des Personalausweises ausreichend.
9. Asylberichtigte, Flüchtlinge und heimatlose Ausländer/innen
In der Bundesrepublik Deutschland anerkannte Asylberechtigte, ausländische Flüchtlinge nach § 60 Abs. 1 AufenthG bzw. dem früheren § 51 Abs. 1 AuslG und heimatlose Ausländer/innen unterliegen deutschem Personalstatut, wenn diese ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Anerkannte Asylberechtige, anerkannte Flüchtlinge nach § 60 Abs. 1 AufenthG bzw. dem früheren § 51 Abs. 1 AuslG und heimatlose Ausländer/innen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben daher für eine beabsichtige Eheschließung kein Ehefähigkeitszeugnis vorzulegen und bedürfen auch keiner Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses.
10. Meldebescheinigungen und ausländerrechtlicher Status
Dem Antrag sind für Braut und Bräutigam aktuelle Aufenthaltsbescheinigungen des deutschen Meldeamts mit ausdrücklicher Angabe des Familienstandes beizufügen, sofern sie ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Die Vorlage sog. Meldebescheinigungen ohne Familienstandsangabe sind nicht ausreichend. Außerdem sind noch unmittelbar vor Antragstellung eingetretene Familienstandsveränderungen durch das Meldeamt zu berichtigen.
Zudem haben sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhaltende ausländische Verlobte ihren ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus durch die Vorlage eines gültigen Aufenthaltstitels (z.B. Niederlassungserlaubnis, Duldung, Visum, etc.) nachzuweisen. Personen mit der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (sog. Unionsbürger/innen) benötigen aufgrund des in den Staaten der Europäischen Union geltenden Freizügigkeitsrechts keinen besonderen Nachweis über die Aufenthaltsberechtigung in der Bundesrepublik Deutschland.
11. Nachweis aller Vorehen und deren Auflösung
Die jeweils letzten Vorehen der Verlobten sowie deren wirksame Auflösung sind durch Vorlage der Heiratsurkunde und entsprechender Nachweise zur Auflösung (z. B. Sterbeurkunde, Abschrift aus dem Eheregister oder Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk) nachzuweisen. Hinweise hierzu sind auch in dem Länderverzeichnis des Oberlandesgerichts Bamberg (s. 2. Länderverzeichnis) zu finden. Ist die letzte Ehe nicht bei einem deutschen Standesamt geschlossen worden, so ist auch die Auflösung etwaiger weiterer Vorehen nachzuweisen.
Gemäß Nr. 1330 des Kostenverzeichnisses zu § 4 Abs. 1 JVKostG sind für Verfahren zur Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses nach § 1309 Abs. 2 BGB Rahmengebühren zwischen 15,00 € und 305,00 € zu erheben. Die Höhe der Kosten richtet sich u. a. nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten, dem Umfang und der Schwierigkeit des Verfahrens sowie den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Antragstellerin / des Antragstellers.
Daher ist dem Antrag ein aktueller Einkommensnachweis beizufügen.